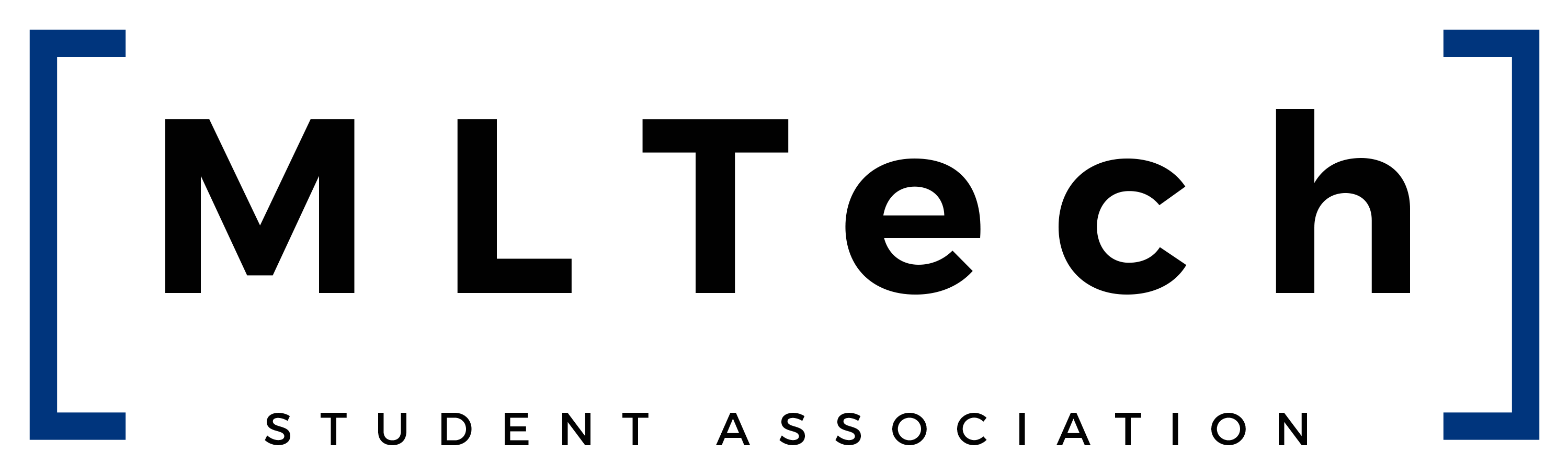beA: Revolution im Rechtsverkehr oder digitales Hindernis?
Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) ist ein zentrales Kommunikationsmittel für Rechtsanwälte untereinander sowie für den Austausch mit der Justiz. Es ermöglicht die elektronische Signatur und verfügt über eine Suchfunktion, mit der alle Rechtsanwälte im Bundesgebiet auffindbar sind, sodass eine explizite Mitteilung der Postfachadresse entbehrlich wird. Seit 2018 besteht eine passive Nutzungspflicht des beA. Dennoch hatten Anwälte zunächst die Wahl, welche Methode sie für die elektronische Signatur und Kommunikation verwenden wollten. [1]
Die gesetzliche Grundlage hierfür findet sich in § 31a Abs. 6 BRAO: „Der Inhaber des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs ist verpflichtet, die für dessen Nutzung erforderlichen technischen Einrichtungen vorzuhalten sowie Zustellungen und den Zugang von Mitteilungen über das besondere elektronische Anwaltspostfach zur Kenntnis zu nehmen.“
Rechtsanwälte waren somit verpflichtet, über das Portal zugestellte Mitteilungen zur Kenntnis zu nehmen und gegen sich gelten zu lassen – eine sogenannte passive Nutzungspflicht mit aktiver Handlungspflicht. Seit dem 1. Januar 2022 gilt darüber hinaus eine generelle aktive Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts. Elektronische Dokumente müssen nun zwingend über das beA-Portal oder andere zugelassene elektronische Kommunikationswege an Gerichte übermittelt werden.
Das beA soll die digitale Aktenführung vorantreiben und den Schriftverkehr effizienter gestalten. Durch die elektronische Fernsignatur werden die Authentizität und Integrität von Dokumenten sichergestellt. Dies gewährleistet, dass Dokumente rechtsgültig bleiben und nachträgliche Änderungen ausgeschlossen sind. Trotz dieser Vorteile gibt es in der Praxis jedoch weiterhin erhebliche Herausforderungen.
Der nachfolgende Blogbeitrag betrachtet das beA aus einer kritischen Perspektive. Dabei werden sowohl die positiven Aspekte als auch bestehende Schwierigkeiten beleuchtet. Untermauert wird die Analyse durch einen direkten Praxisbezug, insbesondere durch die Einschätzungen von Wolfgang Holzberger – Rechtsanwalt mit Schwerpunkt für Immobilienrecht, Forderungsmanagement und Vertragsgestaltung.
Unzugänglichkeit von Dokumenten bei Kanzleineugründungen
Ein gravierendes Problem ergibt sich bei der Neugründung von Kanzleien.[2] Gemäß § 31a Abs. 7 BRAO richtet die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) für jede neu eingetragene Kanzlei eines Mitglieds der Rechtsanwaltskammer ein beA-Postfach ein. Für dieses erhält das Mitglied eine Safe-ID, mit der eine beA-Karte beantragt werden kann. Erst mit Erhalt dieser Karte ist ein Zugriff auf das Postfach möglich. Problematisch ist, dass bereits ab der Einrichtung des beA-Postfachs Nachrichten[3] empfangen werden können, ohne dass der Anwalt tatsächlich darauf zugreifen kann. Dies kann dazu führen, dass fristgebundene Mitteilungen ungelesen bleiben. In solchen Fällen kann nach § 60 Abs. 1 VwGO und § 233 S. 1 ZPO Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gewährt werden.[4] Dennoch wird diese Lösung als unbefriedigend angesehen, da sie im Widerspruch zur Verpflichtung aus § 31a Abs. 6 BRAO steht, Mitteilungen zur Kenntnis zu nehmen. Der Bundesgerichtshof (BGH) empfahl daher, die erste Zustellung neuer Nachrichten mit der Aktivierung des beA zu synchronisieren. Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) sieht jedoch keinen Handlungsbedarf[5] und verweist darauf, dass Anwälte vorsorglich mehrere Karten bei der Erstregistrierung beantragen könnten.[6] Diese Position wurde in der Anwaltschaft stark kritisiert, da vielen Rechtsanwälten diese Regelung nicht bekannt war und eine solche vorausschauende Planung schwer zumutbar ist.[7]
§ 87a Abs. 1 S. 1 – beA-Verbot bei der Kommunikation mit Finanzämtern
Ein weiteres umstrittenes Thema ist das Verbot der Kommunikation mit Finanzämtern über das beA. Der Finanzausschuss hatte ursprünglich eine Änderung des § 87a Abs. 1 S. 1 Abgabenordnung (AO) im Jahressteuergesetz (JStG) 2024 vorgeschlagen.
Dabei sollte folgender Passus im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen vom 08.05.2024 eingefügt werden:
„Wenn für die Übermittlung von Nachrichten und Dokumenten an Finanzbehörden ein sicheres elektronisches Verfahren zur Verfügung steht, das den Datenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes gewährleistet, ist die Übermittlung elektronischer Dokumente an Finanzbehörden mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder über das besondere elektronische Behördenpostfach außerhalb gerichtlicher Verfahren nur zulässig, soweit dies gesetzlich ausdrücklich zugelassen ist.“
Diese Regelung wurde vom Deutschen Anwaltverein (DAV) und der BRAK heftig kritisiert. Unter anderem kritisiert der Deutsche Anwaltverein (DAV) in deren Stellungnahme vom Mai 2024, dass die Einführung mehrerer verpflichtender Kommunikationssysteme ein höheres Risiko der Nichteinhaltung der Kommunikationswege schafft.[8]
Nachdem der Passus zunächst aus dem Gesetzentwurf gestrichen wurde, fand er am 9. September 2024 erneut Eingang in die Vorlage.[9] Hintergrund und Begründung der Einfügung des Passus war, dass die vorhandenen Kommunikationsangebote der Finanzbehörden den Besonderheiten des steuerlichen Verfahrens bereits die besten Angebote wären. Die Angebote der Finanzbehörden beschränken sich auf das ELSTER-Verfahren und die Schnittstelle ERiC. Ein anderer Kommunikationsweg würde zu einem erhöhtem Verwaltungsaufwand führen. Dabei würde ein gut funktionierendes Verfahren erheblich beeinträchtigt werden, indem man ein Dokument in anderer Weise übermitteln würde. Dazu kommt die weitere Einarbeitung der Mitarbeiter in den Finanzbehörden, da das beA lediglich für die elektronische Kommunikation in gerichtlichen Verfahren eingeführt wurde.[10]
Die BRAK hielt in ihrer Stellungnahme vom Oktober 2024 dem entgegen, dass Rechtsanwälte gesetzlich zur Nutzung des beA verpflichtet sind und ein Wechsel auf ELSTER unzumutbar sei. Tatsächlich ist eine Anmeldung für Rechtsanwälte nicht ohne Weiteres möglich, da in der Anmeldemaske lediglich die Berufsbezeichnung „Steuerberater“ auswählbar ist. Zudem stellt die parallele Nutzung mehrerer Systeme für Kanzleien eine erhebliche organisatorische und finanzielle Belastung dar.[11] Trotz massiver Kritik wurde das Jahressteuergesetz 2024 am 18. Oktober 2024 vom Bundesrat mit der beA-Sperre für Finanzämter verabschiedet.[12]
In der angenommenen Fassung des Bundesrats lautet folgendes Verbot:
„Die Übermittlung elektronischer Nachrichten und Dokumente an Finanzbehörden mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder über das besondere elektronische Behördenpostfach ist nicht zulässig, soweit für die Übermittlung ein sicheres elektronisches Verfahren der Finanzbehörden zur Verfügung steht, das den Datenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes gewährleistet; dies gilt nicht für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie in den Fällen, in denen die Übermittlung an Finanzbehörden mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder über das besondere elektronische Behördenpostfach gesetzlich vorgeschrieben ist.“[13]
Sylvia Ruge, DAV-Hauptgeschäftsführerin, begründet die Einbringung des Verbots mit einem „Versehen laut rechtspolitischen Kreisen“.[14] Dies sei für sie jedoch nicht nachvollziehbar, da der entsprechende Passus bereits entfernt worden sei. Nichtsdestotrotz wurde das JStG 2024 vom Bundestag beschlossen und am 05.12.2024 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Infolgedessen ist § 87a Abs. 1 S. 1 AO am 06.12.2024 in Kraft getreten. [15] Der DAV fordert daher umgehend ein Änderungsgesetz.[16]
Vor- und Nachteile aus der Perspektive eines erfahrenen Experten
Weitere Schwierigkeiten in der Praxis betreffen Beschränkungen bei Dateianhängen, da die Vergabe von Dateinamen strengen Vorgaben unterliegt, so Wolfgang Holzberger – Rechtsanwalt mit Schwerpunkt für Immobilienrecht, Forderungsmanagement und Vertragsgestaltung. Zudem bestehen Größenbegrenzungen für Nachrichten, die bestimmte Volumina nicht überschreiten dürfen. Hinzu kommen die finanziellen Aspekte, da neben den Installationskosten auch laufende Gebühren für Zertifikate anfallen.
Trotz dieser Probleme bietet das beA erhebliche Vorteile. Der postalische Versand entfällt, wodurch Kommunikation schneller und effizienter erfolgt. Der Zugriff von unterwegs ermöglicht eine flexiblere Arbeitsweise. Technische Stabilität ist gewährleistet, da das beA vergleichsweise wenige Störungen aufweist. Die Integration in Kanzleisoftware wie RA-Micro und ReNoStar erleichtert die elektronische Aktenführung. Zudem reduziert das beA den Verwaltungsaufwand erheblich, sodass Einzelanwälte, die früher auf Sekretariatsunterstützung angewiesen waren, ihre Organisation nun effizienter gestalten können.
Fazit
Das beA stellt zweifellos einen Fortschritt in der Digitalisierung des Rechtsverkehrs dar. Trotz anfänglicher Widerstände bietet es zahlreiche Vorteile. Gleichzeitig bestehen weiterhin ungelöste Probleme, insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung bei Kanzleineugründungen und der Kommunikation mit Finanzämtern. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Gesetzgeber in Zukunft auf die berechtigte Kritik der Anwaltschaft eingehen wird.
Wir bedanken uns herzlich bei Wolfgang Holzberger für seine wertvolle Zeit und seine praxisnahe Einschätzung. Als Rechtsanwalt, der beA täglich nutzt, hat er uns einen tiefen Einblick in die praktische Anwendung und Herausforderungen gegeben.
Über die Autorin
Sarah Lisiecki (sarah.lisiecki@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Co-Head of Blog bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Über die Redakteure
Luis Hettrich (luis.hettrich@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Chief Editor bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Albert Hans Möller (albert.moeller@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Vorstand bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Allgemeine Anregungen oder Anfragen zum Blog gerne an: blog@ml-tech.org.
[1] Vgl. BRAK: beA &ERV.
[2] Vgl. BGH (Beschl. v. 30.7.2024, AnwZ (Brfg) 13/24).
[3] Vgl. LTO: BMJ reagiert nicht auf BGH-Appell.
[4] Vgl. BGH (Beschl. v. 30.7.2024, AnwZ (Brfg) 13/24) Rn. 31.
[5] Vgl. LTO: BMJ reagiert nicht auf BGH-Appell.
[6] Vgl. LTO: BMJ reagiert nicht auf BGH-Appell.
[7] Vgl. LTO: BMJ reagiert nicht auf BGH-Appell.
[8] Siehe Stellungnahme vom DAV, S. 8.
[9] Vgl. Drs. 20/12780.
[10] Siehe Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung (Drs. 20/13157).
[11] Siehe Stellungnahme der BRAK.
[12] Vgl. BR-Drs. 529/24, S. 49.
[13] Vgl. BR Drs.529/24.
[14] Vgl. Beck-aktuell: DAV fordert: beA-Verbot für Kommunikation mit Finanzamt aus der Welt schaffen